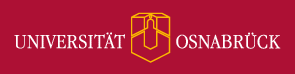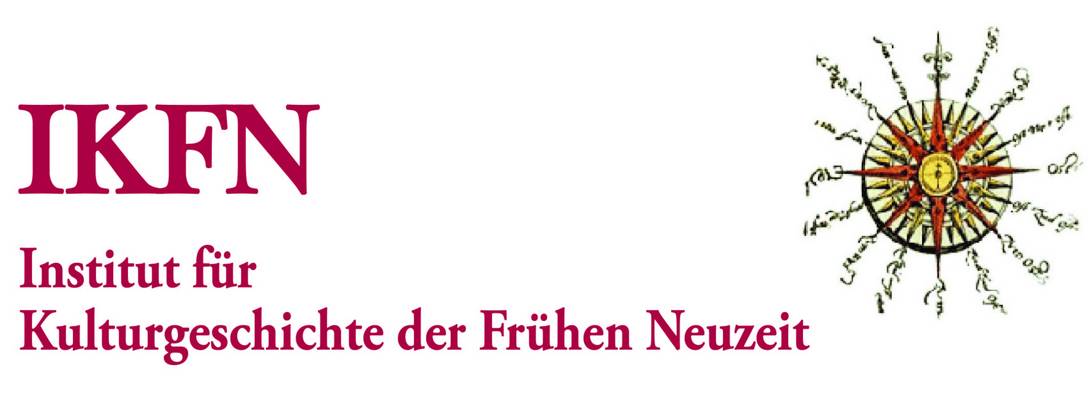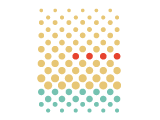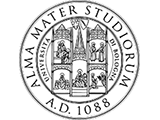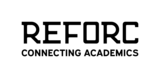Weiterführende Informationen
Fachbereiche und Interdisziplinäre Institute
Topinformationen
„Im Affekt!?“ über Gefühle im Beruf und Gesellschaft
im Rahmen der Gesprächsreihe „Im Affekt!?“ über Gefühle im Beruf und Gesellschaft spricht Pastor Thomas Gotthilf (Ev.-luth. Kirche) mit Prof. Steffie Schmidt (Ev. Theologie) und Prof. Björn Spiekermann (Neuere Deutsche Literatur) über die Rolle von Emotionen im Rahmen der Gefängnisseelsorge, über seine langjährige Arbeit als Seelsorger und Gewaltberater, als Leiter von Meditationsgruppen und kreativen Schreibprojekten an der JVA Lingen.
Emotionen bewegen und setzen in Bewegung. Sie spielen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine viel größere und einflussreichere Rolle, als es ein rationalistisch geprägtes Welt- und Menschenbild lange wahrhaben wollte. Das ist heute so, und es dürfte, wenngleich in anderer Weise, auch für frühere Zeiten gelten. Die Erforschung der Formen des Umgangs mit Affekten in der Vormoderne ist einer der Schwerpunkte des Forschungszentrums Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) der Universität Osnabrück. In der Gesprächsreihe richten wir den Blick von der Vergangenheit aus in die Gegenwart. Wir sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Berufsfelder darüber, welche Bedeutung Emotionen und der Umgang mit ihnen in ihrer täglichen Arbeit haben. Im besten Fall ergibt sich ein lebendiger Austausch, in dem es gelingt, die Gegenwart von der Vergangenheit und die Vergangenheit von der Gegenwart her zu erhellen.
Alle Interessierten, ob von innerhalb oder außerhalb der Universität, sind herzlich eingeladen. Im Anschluss an das von den oben genannten Mitgliedern des IKFN moderiertes Gespräch mit dem Gast soll die Diskussion geöffnet werden und Raum für Fragen und Erfahrungen aus dem Publikum sein.
Die Veranstaltung findet am 19.11.2025 um 19.00 Uhr im Studierendenzentrum, Kolpingstraße 1a, statt.
Neuer Outdoor-Escape-Room "Wettlauf um den Frieden"
Ein geheimes Treffen, ein Codewort und der Frieden am seidenen Faden. Nach dem Erfolg im letzten Jahr (Rette den Frieden! Wo ist Oxenstierna?) richtet das Forschungszentrum Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) der Uni Osnabrück in diesem Jahr den neuen Outdoor-Escape-Room Wettlauf um den Frieden. Das geheime Treffen aus. Am Jubiläumstag des Osnabrücker Handschlages, den 10. August dieses Jahres, können Interessierte sich erneut auf eine spielerische Suche begeben und sich so zum/zur „Friedensretter*in“ krönen. Die Aktion richtet sich an Familien mit älteren Kindern/Jugendlichen sowie alle Interessierten. Zum Mitmachen wird nur ein Smartphone und ein Flyer benötigt, der im Rathaus, in der Marienkirche und im Forum am Dom ausliegt. Das Suchspiel kann alleine oder in einer Gruppe gespielt werden und ist komplett kostenlos.
Eingebettet ist der Outdoor-Escape Room in das vielfältige Angebot zum Jubiläum des Osnabrücker Handschlages am 10. August dieses Jahres. Mit einem Ökumenischen Friedensgottesdienst startet der Veranstaltungstag in St. Marien. Im Anschluss werden neben der modernen Schatzsuche auch Führungen am historischen Stadtmodell in der Marienkirche, im Bischofsgarten und im Diözesanmuseum angeboten. Den Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet die Lesung von Natalia Wörner um 16:30 Uhr in der Marienkirche. Beteiligt sind die Gemeinde von St. Marien, das Diözesanmuseum, der Landschaftsverband, die Stadtarchäologie, die Stadt Osnabrück und das IKFN der Uni Osnabrück.
Workshop "Politisches Scheitern in der Frühen Neuzeit – Erwartungen, Praktiken, Deutungen"
Am 26. und 27. Juni 2025 fand am Forschungszentrum Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) der Universität Osnabrück ein interdisziplinärer Workshop zum Thema „Politisches Scheitern in der Frühen Neuzeit“ statt. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Universität Marburg und der Universität Augsburg organisiert und versammelte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland.
Ziel des Workshops war es, das Phänomen des politischen Scheiterns nicht als bloßen Misserfolg zu betrachten, sondern als komplexen historischen Prozess zu analysieren, der durch Erwartungen, Zuschreibungen und Deutungsmuster geprägt ist. In vier thematischen Sektionen – von Impulsen über Antizipationen bis hin zu Praktiken und Rezeptionen – wurden vielfältige Fallbeispiele diskutiert, darunter gescheiterte Friedensprojekte, politische Wahlen, misslungene Kolonialprojekte und das Rollenverständnis frühneuzeitlicher Akteure.
Die gelungene Veranstaltung unterstrich eindrucksvoll, wie fruchtbar die Auseinandersetzung mit dem Thema „Scheitern“ für die historische Forschung sein kann – jenseits linearer Erfolgserzählungen.
Ein Tagungsbericht wird noch folgen. Die Veranstaltung fand im Kontext des DFG-Projektes Der Prager Frieden von 1635 als Argument statt. Vielen Dank an die DFG für die Unterstützung des Workshops.
Workshop "Reisen – pilgern – migrieren. Ein Workshop zur Mobilität in der Vormoderne"
27.-28. Juni 2025, Schloss Osnabrück (Raum 11/214)
Organisiert von Christian Hoffarth (Kiel) und Christoph Mauntel (Osnabrück)
Formen der Mobilität sind seit langem ein vielbeachtetes Thema der Vormoderne-Forschung. Die thematischen Schwerpunkte und das methodische Instrumentarium einschlägiger Arbeiten haben sich naturgemäß im Laufe der Jahre gewandelt und spezialisiert. So wurden Boten, Diplomatinnen und Missionare, Kaufleute, Scholaren und Pilgerinnen als mobile Gruppen untersucht, Routen und Wegnetzwerke rekonstruiert, die Erfahrung, Beschreibung und Konstruktion von Fremdheit und Alterität analysiert, Aspekte von Körperlichkeit und Emotionalität erforscht, transkulturelle Kontakte und Austauschprozesse in den Blick genommen und vielfältige Formen individueller oder auch kollektiver Migration analysiert – um nur wenige Themen und Ansätze zu nennen.
Der Workshop ist ein Forum für Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen, auf dem Ansätze, Methoden und Zugänge zur Mobilitätsforschung diskutiert werden. Dazu werden laufende Projekte und Forschungsarbeiten vorgestellt, die sich mit Formen des Reisens, Pilgerns und Migrierens in Europa von ca. 500 bis ca. 1800 beschäftigen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Im Würgegriff der Zensur. Politische Publizistik im frühneuzeitlichen Nürnberg
Vortragsankündigung:
Frau Prof. Dr. Karina Kellermann (Universität Bonn) geht in Ihrem Vortrag von der grundsätzlichen literatursoziologischen Frage aus, wie die Städte die Ausbreitung der politischen Publizistik einerseits beförderten und andererseits den Spielraum des Sagbaren kontrollierten und eingrenzten. Für letzteres ist die Zensurpolitik in den Blick zu nehmen; diese wurde in Nürnberg schon früh und konsequent betrieben. Die Strenge der Reichsstadt gegen die Tagespublizistik war drastisch und außergewöhnlich, sie betraf sogar harmlose oder stadtfreundliche Reden und Lieder, wenn sie ohne vorherige Genehmigung veröffentlicht worden waren.
Der Vortrag findet am 17.12.2024 um 18:15 Uhr im Zimeliensaal in der Alten Münze statt.
Madame de Lafayette extra muros – Die internationale Rezeption des Werkes von Madame de Lafayette (19. ‒ 21. Jahrhundert)
Tagungsankündigung vom 28. - 29.November 2024 in Osnabrück
Während die Rezeption des Werkes von Madame de Lafayette in Frankreich bereits mehrfach Gegenstand der Forschung war, sind die internationale Verbreitung ihres Werks und das Ausmaß ihres Einflusses noch weitgehend unerforscht. Eine erste Tagung im letzten Jahr in Nantes, die sich auf die unmittelbare Wirkung der Veröffentlichung ihrer Werke beschränkt hat, hat die Breite und Vielgestaltigkeit ihrer Rezeption in Europa im 17. und 18. Jahrhundert gezeigt. Die Osnabrücker Tagung wird die weitere Entwicklung dieser internationalen Rezeption vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart verfolgen. Beschränkte sich die erste Rezeption auf Europa, so lassen die folgenden Jahrhunderte eine weltweite Verbreitung des Werkes von Madame de Lafayette erkennen, die von Amerika bis nach China reicht.
Die Tagung findet in französischer Sprache statt.
IKFN präsentiert Outdoor-Escape-Room "Rette den Frieden!"
Am Sonntag, den 11. August 2024, erinnert das IKFN in Kooperation mit dem Diözesanmuseum an den Osnabrücker Handschlag, der vor 376 Jahren den Teilfrieden zwischen Schweden, dem Kaiser und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation besiegelte und den Weg zum Westfälischen Frieden weiter ebnete. Verschiedene Programmpunkte rücken dieses wichtige Ereignis am Veranstaltungstag ins Licht: Neben Führungen, Schauspiel und Präsentationen von archäologischen Funden können sich Interessierte im Rahmes des Outdoor-Escape-Rooms "Rette den Frieden!" auf die Suche nach dem schwedischen Gesandten Oxenstierna begeben, der kurz vor dem Abschluss des Teilfriedens verschwunden ist...
Eindrücke vom Veranstaltungstag finden Sie hier.
"Laufende Forschungen zur Frühen Neuzeit" - Ein Nachbericht zum Doktorand:innenworkshop in Augsburg
Am 28. Juni trafen sich Doktorand:innen und Postdoktorand:innen des Zentrums für Historische Friedensforschung (Bonn), des Instituts für Europäische Kulturgeschichte (Augsburg) und des Forschungszentrums Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (Osnabrück) in Augsburg im Rahmen der Workshopreihe "Laufende Forschungen zur Frühen Neuzeit" zum fachlichen Austausch. Ein Bericht über das Workshopprogramm kann über die Seite der Universität Augsburg unter folgendem Link nachgelesen werden: